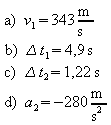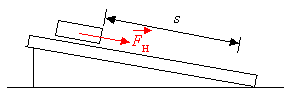
Ein Körper, dessen Geschwindigkeit sich ändert, führt eine beschleunigte Bewegung aus. Eine Geschwindigkeitsänderung kann in einer Änderung des Betrages der Geschwindigkeit, einer Änderung der Richtung der Bewegung oder in einer Änderung beider Größen bestehen.
Zunächst soll die geradlinig beschleunigte Bewegung betrachtet werden, bei der sich nur der Betrag der Geschwindigkeit ändert.
Eine Luftkissenfahrbahn wird leicht geneigt. Die Hangabtriebskraft wirkt dann als beschleunigende Kraft auf den Gleiter. Gemessen wird die Zeit, die der Gleiter benötigt, um verschieden lange Strecken zurückzulegen.
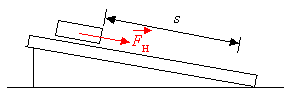
Messwerte:
Eingestellt wurde jeweils die Strecke s. Die Zeitmessung erfolgte mit einem elektronischen Zähler, der mit Lichtschrankensignalen gestartet und gestoppt wurde. In der Tabelle sind zu jeder Strecke s die Mittelwerte aus 3 Einzelmessungen der Zeit t eingetragen.
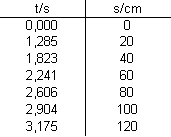
Auswertung:
Ein proportionaler Zusammenhang von t und s ist auf den ersten Blick auszuschließen.
Die graphische Darstellung der Messwerte lässt
vermuten, dass ein quadratischer Zusammenhang vorliegen könnte: ![]() .
.
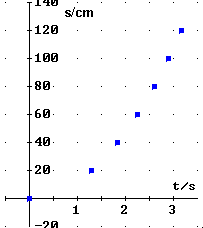
Die rechnerische Überprüfung zeigt, dass der Quotient s/t2 als konstant betrachtet werden kann:
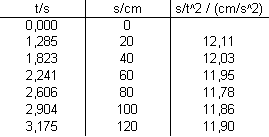
Als Mittelwert ergibt sich:
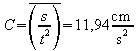 .
.
Die Zeit-Ort-Gleichung der Bewegung lautet also
![]() .
.
Der Graph passt sich den Messwerten gut an:

|
|
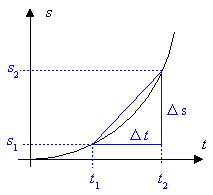 |
Je kleiner aber das Zeitintervall ![]() gewählt wird, umso besser stimmt diese Durchschnittsgeschwindigkeit
mit der Geschwindigkeit in einem beliebigen Zeitpunkt dieses Zeitintervalls
überein.
gewählt wird, umso besser stimmt diese Durchschnittsgeschwindigkeit
mit der Geschwindigkeit in einem beliebigen Zeitpunkt dieses Zeitintervalls
überein.
Messung:
Um aus den obigen Messdaten die Geschwindigkeit näherungsweise zu bestimmen, wird wie folgt vorgegangen:

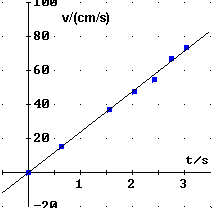
Zu vermuten ist ein proportionaler Zusammenhang.
Der Mittelwert aus den Quotienten von ![]() ist
ist
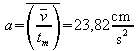 .
.
Die Zeit-Geschwindigkeit-Gleichung der untersuchten beschleunigten Bewegung lautet also:
![]() .
.
Der Vergleich von
![]() und
und ![]()
zeigt noch, dass
![]()
und damit
![]()
ist.
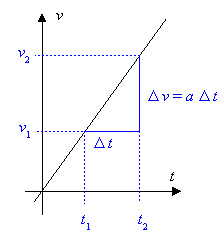 |
Daraus ergibt sich die Maßeinheit:
![]() .
.
Wenn wie im vorliegenden Fall die Beschleunigung konstant ist, heißt die Bewegung gleichmäßig beschleunigt. Beginnt die Bewegung zum Zeitpunkt t0 = 0 am Ort s0 = 0 aus der Ruhe heraus v0 = 0, dann lauten ihre Bewegungsgleichungen:
![]() .
.
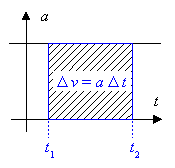
In diesem Diagramm lässt sich die in einem
Zeitintervall ![]() erfolgende Veränderung der Geschwindigkeit
erfolgende Veränderung der Geschwindigkeit ![]() finden: das Produkt
finden: das Produkt
![]()
lässt sich geometrisch als eine Rechteckfläche deuten. Die Geschwindigkeitsänderung entspricht also der Rechteckfläche unter dem t-a-Graphen im t-a-Diagramm.
Im
Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm (t-v-Diagramm)
lässt sich der in einem Zeitintervall ![]() zurückgelegte Weg
zurückgelegte Weg ![]() finden: der Ausdruck
finden: der Ausdruck
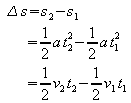
lässt sich geometrisch als Differenz von Dreieckflächen deuten. Der zurückgelegte Weg entspricht also Dreieckflächen und ihren Differenzen unter dem t-v-Graphen im t-v-Diagramm.

Von den 4 Größen t, a,
v,
s müssen 2 gegeben sein; die fehlenden 2 können dann wie
folgt berechnet werden.
| gegeben: | Rechnung: | Beispiel: |
|---|---|---|
|
a, t |
 |
Ein Fahrzeug beschleunigt beim Start 8 s lang mit 1,3 m/s2. Welche Geschwindigkeit erreicht es und wie lang ist die Beschleunigungsstrecke? |
|
a, v |
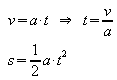 |
Ein Flugzeug beschleunigt beim Start mit 2 m/s2. Die zum Abheben erforderliche Geschwindigkeit ist 380 km/h. Wie lange dauert der Startvorgang und welche Länge muss die Startbahn haben? |
|
a, s |
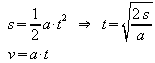 |
Ein Körper wird aus der Ruhe heraus mit 0,08 m/s2 gleichmäßig beschleunigt. In welcher Zeit legt er einen Weg von 100 m zurück und wie groß ist dann seine Geschwindigkeit? |
|
v, t |
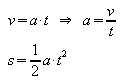 |
Eine Lokomotive fährt aus dem Ruhezustand beschleunigt an und erreicht nach 40 s die Geschwindigkeit 85 km/h. Wie groß ist die Beschleunigung und welche Entfernung vom Ausgangsort hat sie dann? |
|
v, s |
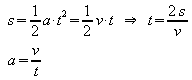 |
Ein Fahrzeug wird aus der Ruhe heraus gleichmäßig beschleunigt und erreicht nach einer Strecke von 80 m die Geschwindigkeit 20 m/s. Wie groß ist die Beschleunigung und wie lange dauert der Beschleunigungsvorgang? |
|
s, t |
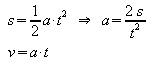 |
Auf einer geneigten Luftkissenfahrbahn durchfährt ein Gleiter aus der Ruhe heraus in 0,84 s die Strecke 1,0 m. Wie groß ist die Beschleunigung und welche Geschwindigkeit erreicht der Gleiter? |
Ergänzung: In den Fällen, in denen die Zeit t unbekannt ist, kann auch die Methode der Elimination der Zeit verwendet werden.
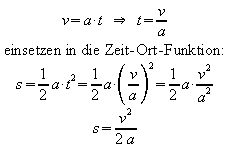
a) gegeben: a, s
![]()
b) gegeben: v, s
![]()
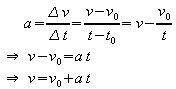
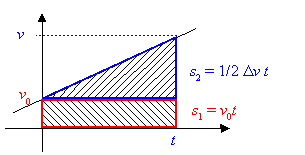
Die Rechteckfläche unter dem t-v-Graphen im t-v-Diagramm entspricht wieder dem zurückgelegten Weg, so dass sich die Zeit-Weg-Gleichung ergibt:
![]()
![]()
Da sich der Körper zur Zeit t0 = 0 schon an einem von Null verschiedenen Ort s0 befinden kann, ergibt sich als allgemeinste Zeit-Weg-Gleichung für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung:
![]()
Beispiel: Beschreibung einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung
Gegeben ist ein Zeit-Geschwindigkeit-Diagramm.
Die Bewegung beginnt zur Zeit
t0 = 0 am Ort
s0 = 0 aus der Ruhe heraus
(v0 = 0).
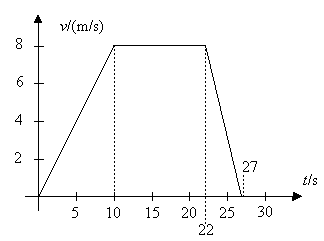
1) Im Zeitintervall t = 0 ... 10 s steigt die Geschwindigkeit linear an. Die Beschleunigung ist
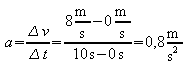 .
.
Die zurückgelegte Strecke ergibt sich aus
![]() .
.
Die Bewegungsgleichungen lauten
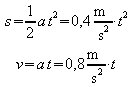 .
.
2) Im Zeitintervall t = 10 s ... 22 s ändert sich die Geschwindigkeit nicht – es liegt also eine gleichförmige Bewegung vor. Die zurückgelegte Strecke kann aus der Fläche unter dem t-v-Graphen ermittelt werden:
![]()
Die Zeit-Ort-Gleichung lautet:
![]() .
.
3) Im Zeitintervall t = 22 s ... 27 s nimmt die Geschwindigkeit linear ab. Die Beschleunigung nimmt deswegen einen negativen Wert an:
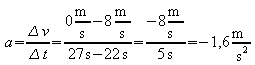 .
.
Bewegungsgleichungen:
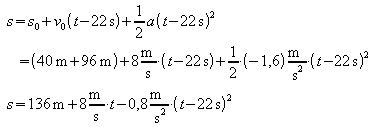
![]()

Übungen (1)
empfohlene Aufgaben aus dem Lehrbuch:
S.29, A2, A3, A4, A6
Übungen (2)
1. Ein Fahrzeug bewegt sich nach dem Start aus der Ruhe heraus 15 s lang mit einer konstanten Beschleunigung a und erreicht dabei die Endgeschwindigkeit v1.Mit dieser (jetzt konstanten) Endgeschwindigkeit bewegt sich das Fahrzeug weiter. 40 s nach dem Start hat das Fahrzeug 812,5 m zurückgelegt.
a) Skizzieren Sie das t-v-Diagramm.
b) Berechnen Sie die Beschleunigung a und die Endgeschwindigkeit v1.
2. In einem Autotest wird bei einem mit v0 = 100 km/h fahrenden PKW eine Vollbremsung durchgeführt. Der Bremsweg beträgt 49 m. Berechnen Sie die Beschleunigung a, wenn angenommen wird, dass die Beschleunigung während des Bremsvorgangs konstant ist.
3. Gegeben ist das t-v-Diagramm einer Bewegung.
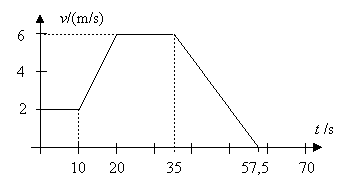
a) Beschreiben Sie die Bewegung.
b) Berechnen Sie die Beschleunigungen in den
Zeitintervallen.
c) Berechnen Sie den jeweils in einem Zeitintervall
zurückgelegten Weg.
d) Welche Entfernung hat der Körper zur
Zeit
t = 70 s vom Ausgangspunkt?
4. Gegeben ist das t-v-Diagramm einer Bewegung.

a) Beschreiben Sie die Bewegung.
b) Wie weit entfernt sich der Körper in
positiver Bewegungsrichtung maximal vom Ausgangspunkt?
c) Wie weit ist der Körper zur Zeit t
= 18 s vom Ausgangspunkt entfernt?
d) Nach welcher Zeit bewegt sich der Körper
wieder durch den Ausgangspunkt?
Weitere Übungen
1. Ein Fahrzeug wird gleichmäßig beschleunigt; die Zeit-Weg-Funktion lautet
![]() .
.
a) Welche Wegstrecke s1 legt
das Fahrzeug in dem Zeitintervall D t1
von
t0 = 0s bis t1 = 15 s zurück?
Wie groß ist die Durchschnittsgeschwindigkeit
in diesem Zeitintervall?
b) Wie lange dauert die Bewegung zwischen den
Orten mit den Koordinaten s0 = 0 m und s2
= 25 m?
c) In welcher Zeitspanne Dt2,3
wird die Strecke zwischen den Orten mit den Koordinaten s2
= 25 m und s3 = 75 m zurückgelegt? Wie groß
ist die Durchschnittsgeschwindigkeit in dieser Zeitspanne?
d) In welcher Zeitspanne Dt3,4
wird die Strecke zwischen den Orten mit den Koordinaten
s3
= 75 m und s4 = 125 m zurückgelegt? Wie groß
ist die Durchschnittsgeschwindigkeit in dieser Zeitspanne?
e) Welche Wegstrecke Ds5,6
wird in der Zeit von t5 = 17 s bis t6
= 42 s zurückgelegt?
2. Der Pfeil einer Armbrust wird längs einer 0,30 m langen Beschleunigungsstrecke auf die Endgeschwindigkeit 66,0 m/s beschleunigt. Vereinfachend wird angenommen, dass die Bewegung gleichmäßig beschleunigt ist. Wie lange dauert der Beschleunigungsvorgang?
3. Ein Flugzeug startet und erreicht nach
der Rollstrecke von 2,6 km die zum Abheben nötige Geschwindigkeit
von 340 km/h. Es wird angenommen, dass es sich um eine gleichmäßig
beschleunigte Bewegung handelt.
Wie lange rollt das Flugzeug beim Startvorgang?
Wie groß ist die Beschleunigung?
4. Ein PKW beschleunigt
a) aus der Ruhe heraus auf 80 km/h in 8,5 s,
b) von 100 km/h auf 120 km/h in 7,4 s,
c) von 120 km/h auf 140 km/h in 15,7 s.
Wie groß sind die mittleren Beschleunigungen
in den einzelnen Zeitintervallen?
5. Ein Körper bewegt sich zur Zeit
t
= 0 mit der Geschwindigkeit v0 = 10 m/s längs einer
geraden Bahn. Er wird dann (beginnend mit t = 0) abgebremst, d.h.
seine Beschleunigung ist negativ:
a = –0,5 m/s2.
a) Zeichnen Sie das Zeit-Geschwindigkeit-Diagramm.
b) Ermitteln Sie aus der Zeichnung die Länge
des Bremsweges sB, also die Länge des Weges, den
der Körper von t = 0 bis zum Zeitpunkt des Stillstands zurücklegt.
6. Die Geschwindigkeit eines Zuges beträgt
v0
= 120 km/h. Bei einer Notbremsung wird ein Bremsweg von 500 m zurückgelegt.
Der Bremsvorgang kann als gleichmäßig beschleunigte Bewegung
betrachtet werden.
a) Wie lange dauert es, bis der Zug zum Stillstand
kommt?
b) Wie groß ist die Beschleunigung, die
auf den Zug wirkt?
7. Von der US-Air-Force wurden 1954 Beschleunigungsversuche
auf einer geraden Schienenstrecke durchgeführt, mit denen die Belastbarkeit
des Menschen für Raumfahrtprojekte untersucht wurde. Ein Schlitten
wurde mit Raketentriebwerken längs der Teilstrecke s1
= 840 m mit der Beschleunigung a = 70 m/s2 in Bewegung
gesetzt. Auf einem zweiten Streckenteil der Länge s2
= 210 m wurde der Schlitten mit Bremsschaufeln, die in ein Wasserbecken
eintauchten, abgebremst. Die Bewegungen können als gleichmäßig
beschleunigt betrachtet werden.
a) Welche Geschwindigkeit erreichte der Schlitten
am Ende der ersten Teilstrecke?
b) Wie lange dauerte der Beschleunigungsvorgang
auf dieser Strecke?
c) Wie lange dauerte der Bremsvorgang auf der
zweiten Teilstrecke?
d) Mit welcher Beschleunigung a2
wurde der Schlitten gebremst?
Lösungen
1.
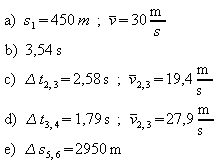
2.
![]()
3.

4.
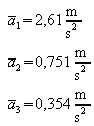
5. a)
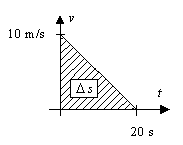
![]()
6.
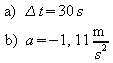
7.