Bei
Potenzfunktionen ist die Basis die
Variable: ![]() .
Die Definitionsmenge ist dabei nach dem Exponenten zu wählen.
.
Die Definitionsmenge ist dabei nach dem Exponenten zu wählen.
Bei
Exponentialfunktion ist die Hochzahl
die Variable: ![]() .
.
| Def.: Für |
Beispiele:
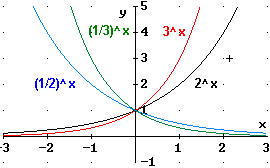
Die Graphen lassen vermuten, dass eine Exponentialfunktion
- unabhängig von der Basis a - immer positive Funktionswerte
annimmt. Dies trifft tatsächlich zu, wie hier aber nicht bewiesen
werden soll:
| Die Wertemenge einer
Exponentialfunktion
|
Aus den Definitionen für Potenzen (s. Abschnitt 1) ergeben sich sofort einige spezielle Werte der Exponentialfunktion zur Basis a:

Aus dem Rechengesetz der Multiplikation von Potenzen gleicher Basis folgt die sogenannte Funktionalgleichung:

2. Exponentialfunktionen sind für die Beschreibung von Wachstums- und Zerfallsvorgängen bedeutsam. Als Beispiel sei der Zerfall eines radioaktiven Elements betrachtet. Bei radioaktivem Zerfall nimmt die Anzahl N(t) der Atome des aktiven Elements mit der Zeit t ab, da sie sich in Atome eines anderen Elementes umwandeln. Beträgt zur Zeit t = 0 die Anzahl der aktiven Atome N0 = N(0), so ist die Anzahl der Atome in Abhängigkeit von der Zeit durch eine Funktion der Art
![]()
zu beschreiben.
Physikalische Untersuchungen haben ergeben, dass
jedes radioaktive Element eine
Halbwertszeit tH
besitzt, nach der sich die Anzahl der aktiven Atome halbiert hat. Beispiel:
Sei ![]() und
und ![]() ;
dann halbiert sich alle 5 min der Bestand an aktiven Atomen:
;
dann halbiert sich alle 5 min der Bestand an aktiven Atomen:
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ein solcher Verlauf lässt sich mit einer Exponentialfunktion mit 0 < a < 1 wiedergeben:
![]() .
.
Die Basis a kann mithilfe der Halbwertszeit ermittelt werden:

Die Zerfallsfunktion lautet also
![]() .
.
Die Ableitung der Zerfallsfunktion ist die Zerfallsgeschwindigkeit. Sie soll hier durch den Differenzenquotienten, also die mittlere Änderungsrate angenähert werden:
![]() .
.
Da der Bestand N(t) sich beim Zerfall verringert, ist die Zerfallsgeschwindigkeit negativ.

Als Aktivität A(t) bezeichnet man die Anzahl von Zerfällen pro Zeiteinheit:
![]() .
.

Die Werte lassen vermuten, dass sich Zerfallsgeschwindigkeit und Aktivität mit der gleichen Halbwertszeit tH verändern wie der Bestand N(t) der aktiven Atome. Das würde bedeuten:
![]() .
.
Der Betrag der Zerfallsgeschwindigkeit (und damit die Aktivität) wäre damit proportional zum momentanen Bestand an aktiven Atomen.
3. Wenn die Aktivität in Abhängigkeit
von der Zeit bekannt ist und weiter noch die Anzahl N0
vorliegt, kann aus diesen Daten der Bestand an aktiven Atomen rekonstruiert
werden. Beispiel: Durch Messungen sei die Aktivität zu jeder Stunde
bestimmt, d.h.
A(t) liegt in Form einer Tabelle vor:
 |
 |
Der Anfangsbestand sei ![]() .
.
Die Aktivität wird durch den Differenzenquotienten angenähert:
![]() .
.
Daraus ergibt sich
![]() .
.
Beginnend bei t = 0 kann nun gerechnet werden:

Der Term ![]() ,
der bei diesen Rechnungen immer wieder auftritt, lässt sich geometrisch
deuten als die Fläche eines Rechtecks im Aktivitätsdiagramm:
,
der bei diesen Rechnungen immer wieder auftritt, lässt sich geometrisch
deuten als die Fläche eines Rechtecks im Aktivitätsdiagramm:

Anders gesagt: Der Bestand N(t) ergibt sich durch Integration der Aktivität:
![]() .
.
Um die Genauigkeit zu verbessern, empfiehlt sich im vorliegenden Fall nicht Rechteckstreifen zu benutzen, sondern das Trapezverfahren zu verwenden.

Fragen und Übungen
1. Was ist der Unterschied zwischen einer Potenzfunktion und einer Exponentialfunktion?
2. Wie ist die „Exponentialfunktion zur Basis a“ definiert? Geben Sie die Definitions- und die Wertemenge an.
3. Wie lautet die Funktionalgleichung der Exponentialfunktion zur Basis a?
4. Welche Probleme entstehen, wenn in dem Term ![]() beliebige reelle Werte für x eingesetzt werden?
beliebige reelle Werte für x eingesetzt werden?
5. Vereinfachen Sie: 
6. Welche Exponentialfunktion hat an der Stelle x = 2 den Funktionswert 5?
7. Legen Sie eine Wertetabelle an:
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Was fällt auf?
Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Graphen
von ![]() ?
?
Können Sie eine Begründung für
Ihre Beobachtungen angeben?
8. Bestimmte Wachstumsprozesse können mit
Exponentialfunktionen ![]() beschrieben werden. Entsprechend zum Begriff der Halbwertszeit bei einem
Zerfallsvorgang gibt es hier eine Verdoppelungszeit tD,
das ist das Teitintervall, in dem sich ein momentaner Bestand verdoppelt.
Zeigen Sie, dass bei Kenntnis der Verdoppelungszeit sich die Basis a
ermitteln lässt und dass gilt
beschrieben werden. Entsprechend zum Begriff der Halbwertszeit bei einem
Zerfallsvorgang gibt es hier eine Verdoppelungszeit tD,
das ist das Teitintervall, in dem sich ein momentaner Bestand verdoppelt.
Zeigen Sie, dass bei Kenntnis der Verdoppelungszeit sich die Basis a
ermitteln lässt und dass gilt ![]() .
.
9. Bilden Sie für das exponentielle Wachstum ![]() die mittlere Wachstumsgeschwindigkeit
die mittlere Wachstumsgeschwindigkeit ![]() .
Leiten Sie daraus die Vermutung ab, dass die Wachstumsgeschwin- digkeit
proportional zum momentanen Bestand sein könnte:
.
Leiten Sie daraus die Vermutung ab, dass die Wachstumsgeschwin- digkeit
proportional zum momentanen Bestand sein könnte: ![]() .
.
10. Zeigen Sie, dass beim exponentiellen Wachstum
gilt: ![]() .
.